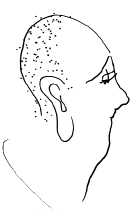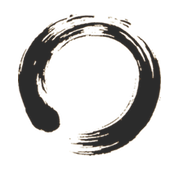Meine satirischen Kolumnen der Redaktionsgeisha wurden zwischen 2009 und 2012 in einem Heilpraktiker-Magazin veröffentlicht. Seitdem hat sich in der Gesundheitspolitik viel verändert. Damals versuchten die Lobbyisten noch, Minister der Bundesregierung zu beeinflussen. Heute sind die Lobbyisten Minister der Bundesregierung und jede angebliche Verbesserung im Gesundheitswesen wirft nicht die Frage auf, wem sie hilft, sondern wer damit Kasse macht. (ep)
Als Dr. Hubertus Canditus Bercelmeyer geweckt wurde, war es spät – zu spät. Die Sprechstunde hatte längst begonnen. Das Wartezimmer im Erdgeschoss seines Hauses war überfüllt von Patienten, die sich mittels alter Frauenzeitschriften und zerfledderter Kinderbücher am „Virus des Monats“ infizierten. Die rostige Reibeisenstimme der langjährigen Sprechstundenhilfe Maria Clarius hatte ihn aus seinen Träumen gerissen:
„Herr Doktor, könnten Sie bitte runterkommen! Ich habe ihren Steuerberater auf der Eins … und der Herr Sibelius in Kabine 2 behauptet, er würde frieren.“
Bercelmeyer hatte keine Lust. Nicht auf diese Heerschar übergewichtiger Jammerlappen und Simulanten und schon gar nicht auf die Kranken, die ansteckend waren, was eine erhoffte Berufung in die Senioren-Mannschaft des Golfclubs gefährden könnte. Am wenigsten Lust hatte er auf den Sprechanlagen-Terror dieser Praxis-Domina, die ihn jeden Montagmorgen aus seinem liebsten Traum riss: Siegerehrung. Bercelmeyer hofft auf den ersten Preis. Über die Lautsprecheranlage hört er seinen Namen – aber dann es ist doch nur das Kasernenhofschnarren der Maria Clarius: „Dr. Bercelmeyer, könnten Sie endlich runterkommen!“
„Ich hätte dieses Weib damals heiraten sollen“, murmelte er, „dann wäre ich sie längst los.“
Eine frühe Heirat und stattliche Versorgung im Scheidungsfall waren die leider unerfüllten Träume der Maria Clarius gewesen. Dass ihr der dröge Landarzt niemals unter den gestärkten Kittel ging, erklärte sie sich mit dem chronischen Erschöpfungszustand des unsportlichen Bercelmeyer, bis der dann im Spätsommer seines Lebens den Golfweg beschritt. Misstrauisch beäugte sie diese neue Partnerschaft des Herrn Doktor.
Das Golfspiel erweckte in Bercelmeyer überraschenderweise jene Leidenschaft, die zu Erleben Frau Clarius einst ihren jungfräulichen Lenden zugedacht hatte. Zu ihrer größten Verwunderung war der kurzatmige Frosch gewillt und in der Lage, an glühend heißen Sonntagen achtzehn Golfbahnen zu hüpfen, selbst wenn es bedeutete, dass die Montags-Sprechstunde erst am späten Vormittag beginnen konnte.
Der Doktor sei zu einem „Notfall“ unterwegs, sagte sie dann und drehte die Augen bedeutungsvoll gen Himmel. Sie überließ es der Phantasie ihrer Heuschnupfenallergiker, sich ein blutrünstiges Drama auszumalen. Damit waren sie eine Weile beschäftigt, denn ein Notfall war grundsätzlich nicht zu hinterfragen. Selbst wenn es länger dauerte – Maria Clarius ließ in ihrem Wartezimmer keine defätistischen Bemerkungen zu.
Der Notfall verleiht dem Arzt die schimmernde Aura des Mittlers, der zwischen dem Patienten und dem Leben steht, wobei – manchmal steht er da auch im Weg. Nicht jeder Ruf in die ewigen Jagdgründe beruht auf dem unergründlichen Ratschluss unseres allmächtigen Herrn. Mangelnde Hygiene in der Krankenstation, die Übermüdung junger Assistenzärzte, manche Patientenverwechslung und die selbstherrlichen Anweisungen ohnmächtiger Halbgötter ließen schon manche Seele zur Unzeit über dem Jordan verglimmen. Aber nicht in dieser Praxis. Das Wort „Notfall“ machte aus Bercelmeyer jenen Arzt, dem zu dienen sich Maria Clarius einst geschworen hatte. Dabei gab es nur einen wirklichen Notfall: Bercelmeyer selbst. Gegen die schweren Erschöpfungszustände, bedingt durch mangelnde Flüssigkeitsaufnahme während eines Golfturniers und übermäßigem Alkoholgenuss danach half nur ein geruhsamer Schlaf. Deshalb lag Bercelmeyer am Montagmorgen schnarchend im Bett, anstatt seine Patienten ins Jenseits zu therapieren – was diese instinktiv zu schätzen wussten.
„Manchmal dauert es, aber er ist ein guter Arzt“ sagte eine Dame. „Zumindest bringt er niemanden um“, bestätigte eine andere.
Bercelmeyer, dessen Golfspiel unter einem unberechenbaren Ballflug leidet, hat die Heilkunst wahrlich von der Pike auf gelernt. Hinter dem schweren, dunkelbraunen Eichenschreibtisch, der das Sprechzimmer wie eine Trutzburg dominiert, hatte sich schon sein Vater verschanzt, während der kleine Hubertus am Boden saß und versuchte, einer widerspenstigen Katze mit dem Stethoskop Herztöne zu entlocken. Nach einem feuchtfröhlichen Studium und Promotion in Heidelberg hatte ihn der bei Landärzten übliche frühe Tod seines Vaters vorzeitig in die Heimat zurückbeordert.
Die Praxis war damals eine stattliche Pfründe und Bercelmeyer, der die Hungergehälter von Assistenzärzten in der Uni-Klinik mit Schrecken betrachtete, ließ sich nicht zweimal rufen. Irgendwann stellte er dann Maria Clarius ein, die ihn seitdem unglücklich und aufopfernd liebt. Bercelmeyer dagegen liebt nur das Golfspiel.
An einem Freitag hatte ich in der Praxis angerufen und zu meiner Überraschung wurde der Hörer abgehoben. Man teilte mir mit, dass ich am Montagvormittag vorbeikommen könne, ich müsse nur etwas Zeit mitbringen. Das fand ich insofern erstaunlich, als ich in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht habe, dass es dank moderner Kommunikationsmittel schier unmöglich geworden ist, eine Arztpraxis zu erreichen und wenn jemand den Hörer abnimmt, ist – zumindest für einen gesetzlich versicherten Lebenskünstler wie mich – kein Termin frei. Insofern war ich von Bercelmeyers Praxismanagement beeindruckt und stand am Montagmorgen rechtzeitig auf der Matte. Nicht, dass ich zur Hypochondrie neigen würde – nein, ich bin nur so vorsichtig, wie man das in meinem Alter sein sollte. Deshalb messe ich stündlich den Blutdruck, lasse monatlich ein großes Blutbild machen und ernähre mich hauptsächlich von vitaminreicher, biologisch hochwertiger Kost.
Hubi, wie Dr. Bercelmeyer bei uns im Club genannt wird, hatte mich vor ein paar Jahren in die golfpsychiatrische Abteilung[1] einer Suchtklinik überwiesen. In dieser Klinik wurde ich geheilt. Seitdem spiele ich zwar noch häufig Golf, aber nicht mehr mit Suchtcharakter, sondern eher, weil ich es als meine Bestimmung ansehe.
Während ich wartete und Kindern beim Bemalen von Schablonen mit Märchenmotiven zusah, schleppte sich der Zeiger so langsam voran, wie eine Sonntags-Golfrunde bei schönem Wetter. Schließlich wurde ich aufgerufen.
„Na, wie geht es uns?“ fragte Bercelmeyer.
„Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte im Vorjahr Beschwerden am Knie.“
„Oh?“
„Das war im letzten Winter, als ich mich nach einem Sturz verletzt hatte.“
„Und du bist sicher, dass du dir das nicht eingebildet hast?“
„Dass ich gestürzt bin? Wieso sollte ich mir das einbilden?“
„Ich frage nur. Schließlich musste ich dich seinerzeit in eine psychiatrische Anstalt überweisen
„Hubert, das war zur Kur, ich hatte einen Drehschwindel.“
„Aber du warst dann für Jahre verschwunden. Ich dachte, man hätte dich weggeschlossen.“
„Ich hatte die Gegend verlassen. Jetzt bin ich wieder hier.“
„Und deinem Knie geht es besser.“
„Akupunktur hat gut geholfen.“
„Dieser Chinesenkram? Alles Einbildung, wobei – stimmt – bei dir könnte das funktionieren. Und warum bist du heute hier?“
Ich erzählte lange, bis Maria Clarius auftauchte. Sie schaute Bercelmeyer mit fragenden Augen an und sprach dann das Zauberwörtchen NOTFALL, um ihn aus dem Sprechzimmer zu locken.
Er stand auf, bedeutete seiner Mitarbeiterin, dass er sofort käme und sagte laut: „Wir sollten deinen Kopf röntgen, oder – nein, wir machen besser gleich ein CT, ein MRT und eine neurologische Untersuchung. Der Kollege Wulff hat sich ein neues Gerät zugelegt, das sich amortisieren muss“
Leise sagte er mir: „Komm mal nach der Sprechstunde vorbei, ich möchte die ganze Geschichte hören.“
…weiterlesen in Die Redaktionsgeisha
[1] Siehe „Golf Gaga – Der Fluch der weißen Kugel“