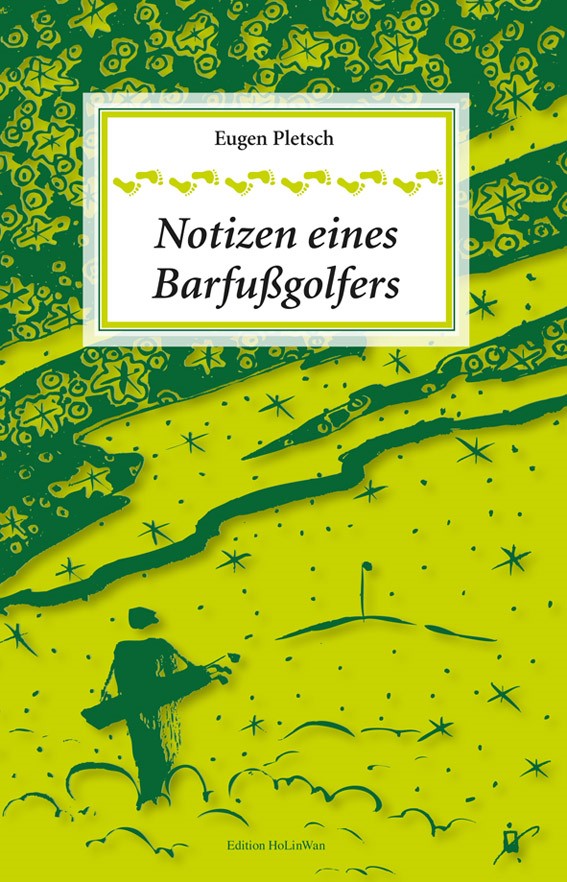Langsam wird mir bewusst, was es bedeutet, dass ich kein Golf mehr spiele: Ich fühle mich großartig, bin mental gefestigt, habe mich seit Wochen nicht mehr über mein Spiel geärgert, keinen Ball verloren, keine Zeit mit Warten vertrödelt, mich nicht mehr über irgendwen oder irgendwas geärgert. „Einfach häärlisch“, wie Frau Oelmann rufen würde.
Mein alter Freund Tim hat einmal gesagt, der beste Golftipp wäre „zwei Wochen nicht zu spielen, um dann nie wieder anzufangen“. Da ist was dran. Erst durch das Nichtspiel habe ich das Golfsein erfahren dürfen. Das erinnert an den Begriff des „Nichtseins“ im ZEN, den man erst versteht, wenn man die Nichtexistenz des Nichts im Sein erfahren hat, wobei das „Nicht Sein“ keinesfalls mit „nichts sein“ zu verwechseln ist, was wiederum etwas anderes bedeutet, als das buddhistische „Nichts“ und das hat überhaupt gar nichts mit „nichts“, geschweige mit dem „Nichts“ zu tun. Das nur am Rande.
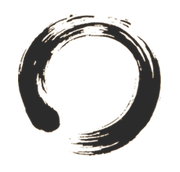
Ich entdecke, dass es ein Leben außer dem Golfspiel gibt. Erstaunlich, wie viel Zeit es jetzt in (m)einem golffreien Universum gibt. Wenn ich mein sommerliches Arbeitspensum rückblickend betrachte, also zum Beispiel den „WEG“ anstatt einer Woche drei Monate lang überarbeiten, nebenher endlos viele Mails schreiben, stundenlange Telefonate, Korrespondenzen, Lesungen und nebenher das Cybergolf-Relaunch und andere offenen Baustellen, dann wundere ich mich, wie ich es geschafft habe, auch noch meinen Job zu machen, abgesehen von den Stunden, die ich täglich auf dem Golfplatz verbrachte.
Das erinnert mich an manchen rasenden Rentner, der sich fragt, wie er früher die Zeit fand, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Schwerwiegende orthopädische Probleme sind übrigens ein deutlicher Indikator dafür, dass ich immer mehr zum etablierten Golf-Schreiberling mutiere. Früher, als ich noch jung und böse war, dachte ich, diese Brüder in den Golfredaktionen hätten alle was am Kopf. Heute weiß ich: Sie haben es eher am Fuß. Oder am Rücken. Auf alle Fälle kommen sie kaum zum spielen und dann ist es verständlicherweise wenig reizvoll, sich durch die durchgeknallten Schriften exzessiver Golfer zu quälen.
Je mehr ich selbst schrieb, umso mehr verstand ich, warum Golfjournalisten, besonders wenn sie selbst Bücher publizieren, keine Rezensionen mehr schreiben. Das ist kein Konkurrenzdenken, sondern eher ein Zeichen von Kollegialität, wenn man nichts schreibt. Und so halte ich es auch. Mittlerweile bekomme ich fast alle Golfbuch-Neuerscheinungen zugeschickt, aber bespreche ich die noch?
Wenn ein saturierter, selbstgefälliger Autor den üblichen chauvinistischen, hundertmal gehörten „Golferhumor“ widerkäut, der alle gängigen Vorurteile gegen Golfer nur bestätigt, dann hätte ich das früher vielleicht in diesem Blog vielleicht zum Thema gemacht. Aber heute? Soll ich meine überflüssige Meinung auf Amazon posten und einen Krieg vom Zaun brechen? Nein. Stattdessen ducke ich mich in meinem Glashaus und hoffe, dass keine Steine fliegen.
Oder nehmen wir diese hübsch gelayoutete Geschenkbücher für Golfer, die alle Zahlen, dummen Witzen und „Golfinfos“ enthalten, die zwei Praktikantinnen in vier Wochen auf der Casting Couch zusammengoogeln können: Das ist für mich keine kreative Arbeit, was ich aber so nie schreiben würde. Zumal es immer noch genug Neugolfer gibt, die solche Bücher einfach köstlich finden. Warum sollte ich denen ihren Spaß verderben?
Sagen wir wie es ist: Um meine Lesergemeinde in diesem Blog wenigstens hin und wieder anzufüttern, habe ich (damals, als ich noch Golf spielte) aus Zeitmangel sogar ältere Texte recycelt, wobei mir und anderen auffiel, dass die allemal besser sind, als das seichte Gefasel, das mir heutzutage immer öfter entgleitet und das, wie der kranke Fuß, ein Indikator dafür ist, dass ich als „Golfautor“ versande. Das alles gibt mir zu denken und ich frage mich wiedermal, ob ich mein Leben nicht generell verändern sollte. Warum nicht? Heuler hat es auch geschafft! Aber ist der Schützenverein für mich wirklich eine Alternative? Sollte ich wieder Straßensänger werden und Bankern auf dem Weg zur Frankfurter U-Bahn Golftipps geben?
Darüber grübelte ich tagelang, bis gestern die Oktoberausgabe des Golfjournals im Kasten lag. Im Golfjournal lese ich am liebsten die „Zahl des Monats“, die mich total fasziniert und die ich manchmal auswendig lerne. Im Oktoberheft (auf Seite 12) war es die stolze Zahl von immerhin 398000 (Yuan). Soviel kostet eine Mitgliedschaft in einem exklusiven Golfclub in der Provinz Zheijang in der Volksdiktatur China. Umgerechnet wären das „circa 44.000 Euro“, ein Betrag, der laut Golfjournal in etwa dem durchschnittlichen Jahreseinkommen eines chinesischen Bauern entspräche. Ein chinesischer Bauer verdient circa 44.000 Euro im Jahr?

Jetzt wusste ich, was ich schon immer werden wollte: Chinesischer Bauer! Im Regal fand ich meine MAO-Bibel, die ich 1967 im Hyde-Park in London von Roten Garden bekommen hatte. Reisbauer in China! Bis zu den Knien im Wasserhindernis stehen und Kohle scheffeln. Wieder googelte ich das Thema. 398000 Yuan entsprachen mittlerweile einem Betrag von 45388 Euro. Das wird ja immer besser, dachte ich, bis ich dummerweise einen Artikel im Hamburger Abendblatt fand, nach dem Landarbeiter angeblich nur 3255 Yuan (330 Euro) im Jahr verdienen. Das ist etwas weniger als 45tausend Euro.
„Aha, mal wieder typisch, die Zahlenakrobaten vom Golfjournal“, dachte ich.
Die Sache ist jedoch noch nicht ganz vom Tisch, denn 330 Euro im Jahr sind immerhin 330 Euro mehr, als ich pro Jahr als Blogger verdiene. Aber gut: Jetzt koche ich erst mal einen Topf Reis, dann sehen wir weiter.
(c) by Eugen Pletsch (ca. 2008)